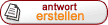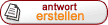|
========== REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4
Titel: Löwenzahn
Kategorien: Info
Menge: 1 Info
============================ QUELLE ============================
-- Erfasst *RK* 12.01.2012 von
-- Christa Gabler
Pflanzen Portrait Löwenzahn und ihre Verwendungsmöglichkeiten.
Löwenzahn, Taraxacum off. Web. (sensu lato) gehört zur Gattung der
Korbblütler. Sie war Pflanze des Jahres 2009. Sie ist salopp gesagt
ein im Garten nicht gern ge gesehener Gast. Geringschätzig wird sie
geflissentlich am Wegesrand übersehen. Einzig und alleine Kinder
erfreuen sich wenn sie die "Pusteblume" in ihrer Reife dem Samen das
Fliegen beibringen. Dennoch, diese Pflanze hat eine bedeutende
Wirkung in der Pflanzenheilkunde. Das verdankt sie ihren neu
entdeckten Wirkstoffen. Sieht man Löwenzahn in Verbindung mit Honig
und folgt dann weiter das er Anziehungspunkt für Bienen ist wird
eine andere Einschätzung gegeben sein. Löwenzahn im Garten als
Anziehungspunkt für Bienen ist ganz nebenbei auch noch nützlich da
die Bienen dann auch noch die blühenden Obstbäume besuchen und damit
für eine Befruchtung sorgen. Folge: Gute Obsternte! Aus dieser
Perspektive gesehen ist der Löwenzahn auch im Garten eine nützliche
Pflanze.
Löwenzahn ist sogar Medizin, nämlich für die Leber und Galle. Die
Inhaltsstoffe helfen der Leber bei ihren Entgiftungsaufgaben. Eßbar
sind übrigens alle Teile des Löwenzahn, von der Wurzel über die
Blätter, Stängel und die Blüten. Der Geschmack ist sehr bitter und
deshalb sollte man z.B. zum Salat nur wenige Blätter beifügen.
Löwenzahn ist zwar nicht giftig aber, es ist ein Korbblütler. Das
bedeute für allergisch reagierende auf Korbblütler: Finger weg! Das
gilt auch wenn Löwenzahn als Zutat zum Salat verwendet wird.
Zunächst der Wachstumsort. Sie mag gerne stickstoffhaltige Böden.
Offensichtlich war die Pflanze vor dem 15. Jh. nicht bekannt.
Erstmals dargestellt wurde sie 1546 wo Hieronymus Bock die
harntreibenden Eigenschaften anführt. Der deutsche Apotheker
Tabernaemontanus bezeichnete sie im 16. Jh. als unvergleichliches
Wundkraut aus. Früher wurden alle Teile der Pflanze, Blüten, Stängel,
Blätter und Wurzeln verwendet.
Was zeichnet diese Pflanze aus, die im Französischen unverblümt als
"Piss-en lit" bezeichnet wird weil sie den Harn fließen läßt. Auch
im Deutschen kennt man den Namen als Bettseichkraut in Richtung der
Anwendung weisend. Klinisch nachgewiesen ist das sie harntreibend
wirkt. Durch eine Lebererkrankung Leidende mit Wassersucht leistet
Löwenzahn vorzügliche Dienste. Überhaupt haben die Wirkstoffe des
Löwenzahn eine besondere Wirkung auf die Leber und Galle.
Andere Namen aus dem Volksmund sind Kuhblume, Pusteblume. Als
Kuhblume bezeichnet weil sie von Kühen auf der Weide gerne gefressen
wird. Pusteblume daher weil nach dem Verblühen eine runder Kegel mit
vielen kleinen "Fallschirmchen", an denen Samen die Samen leichten
Fluges durch den Wind weggetragen werden. Als Kinder haben wir
gewetteifert wie oft man blasen muß um den Löwenzahnstängel von den
kleinen Fallschirmchen zu befreien. Jeder Pustevorgang bedeutete das
wir später ebenso viele Kinder bekommen würden.
Bekannt sind heute einige der Inhaltsstoffe des Löwenzahn wie
Ascorbinsäure, Cholin, den Bitterstoff Taraxin, Nicotinsäure,
ätherisches Öl, Gerbstoff, Harze, Retinol, geringen Anteil Kautschuk,
Inulin, Xanthophylle. Als Vitamine das Provitamin A, Vitamin B und C.
Dazu Mineralsalze und Spurenelemente. Von den Mineralstoffen sind
etwa 5 % Kaliumsalze im Kraut enthalten. Dann die auf die Prostata
wirkenden Phytosterole (Sitosterol, Stigmasterol), Cumarine u.a. Der
Inhaltsstoff Cumarin bei zu Kopfschmerzen oder Migräne neigenden
Patienten ein möglicher Auslöser und deshalb zu meiden.
Zur Verwendung kommend sind Blüten, Blütenstängel, Blätter und
Wurzeln. Die medizinische Anwendung scheint vielfältig zu sein und
vor allem ist sie wegen des Vitamin C gehaltes bei Skrobut früher
viel angewendet worden. Weiter bei Darmträgheit sorgt es für
Bewegung im Darm. Bei Gicht, Rheuma, Appetitlosigkeit und
Hauterkrankungen sind einige Hauptanwendungsmöglichkeiten aus der
naturheilkundlichen Pflanzentherapie. Wegen der harntreibenden
Wirkung ist es eine hervorragende Pflanze bei "Wassersucht". Der
milchige Saft der Stängel soll, von Diabetikern gekaut, den
Zuckerspiegel senken helfen. Den Milchsaft bei jugendlichen Warzen
hier aufgestrichen soll diese verschwinden lassen. Aus eigener
Erfahrung kann ich das bestätigen.
Ein zur Verwendung kommender Presssaft wird hergestellt aus der
jungen, noch nicht geblühten Pflanze, mit den Blättern und noch
kleinen Blütenstängeln. Dieser Presssaft ist zu den so genannten
Frühjahrskuren ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Einnehmens.
Von diesem wird bei entsprechender Diagnose täglich 1 bis 2
Esslöffel genommen. Ein Teeaufguss wird von getrockneten Blüten,
Blättern und klein geheckselten Wurzeln bereitet mit 1 bis 2
Teelöffel auf eine Tasse als Aufguß. Davon bei entsprechender
Indikation täglich 2 bis 3 Tassen warm getrunken.
Als Galletee wirkend gibt es eine Standartzulassung aus der Apotheke
in den entsprechenden Bestandteilen. Dieser besteht aus:
Löwenzahnwurzel 30 g, Mariendistelfrüchte 20 g, Javanischer Gelbwurz
20 g, Pfefferminzblätter 20 g, 10 g Kümmelfrüchte.
Tee und Presssaft sollten immer frisch zubereitet werden.
Im Küchenbereich werden die jungen Blätter vor der Blüte, weil sie
dann noch nicht den bitteren Geschmack entwickeln, fein geschnitten
zum Salat beigegeben. Sogar die Stängel sind essbar. Sie wirken
kräftigend, Verdauung fördernd und appetitanregend. Die Wurzel wurde
früher geröstet und mit der geröstete Wurzel der Wegwarte als
Kaffeeersatz verwendet zum so genannten "Blümchen-Kaffee".
Mein Tipp für einen Frühstücksteller: 1 hart gekochtes Ei schneiden,
eine mittelgroße gekochte Kartoffel in Scheiben geschnitten, eine
Tomate in kleine Stücke geteilt, einige Gurkenscheiben, nach
Geschmack Zwiebelstückchen beifügen, drei kleine Blättchen
Liebstöckel, dann noch sieben bis zehn Blättchen frischen Löwenzahns
und zwei bis drei noch nicht geöffnete Blütenköpfe beilegen. G u t e
n A p p e t i t !
Ein selbst hergestellter Löwenzahnhonig gehört ab jetzt auf den
Frühstückstisch. Er wird gefertigt mit 100 g frischen, geöffneten
Löwenzahnblüten, dazu kann man auch noch einige Gänseblümchenblüten
sowie blühendes Hirtentäschelkraut beifügen. In einem halben Liter
Wasser kurz aufgekocht danach durch ein feines Sieb gelassen. Diese
Essenz wird mit einem halben Kilo Zucker vermengt und einer
zerschnittenen Orange und Zitrone, dazu noch eine Prise
Vanillezucker auf Honigdicke eingekocht.
Zur Fertigung eines Löwenzahngelees nimmt man 150 g frischer
Löwenzahnblüten die mit einem halben Liter Wasser ca. 5 Minuten
gekocht werden. Dann durch ein feines Sieb geben und die Blüten
auspressen. Diesen goldgelben Sud kalt werden lassen, mit einer
ausgepressten Orange und 500 g Gelierzucker beifügend nun wieder
aufkochen. Etwa drei bis fünf Minuten sprudelnd kochen. Danach noch
heiß in entsprechende Glasgefäße einfüllen.
=====
_________________

Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von andern.
So bleibt dir mancher Ärger erspart.

Mein Link
http://www.straight-world.de/index.php?refid=3432
|